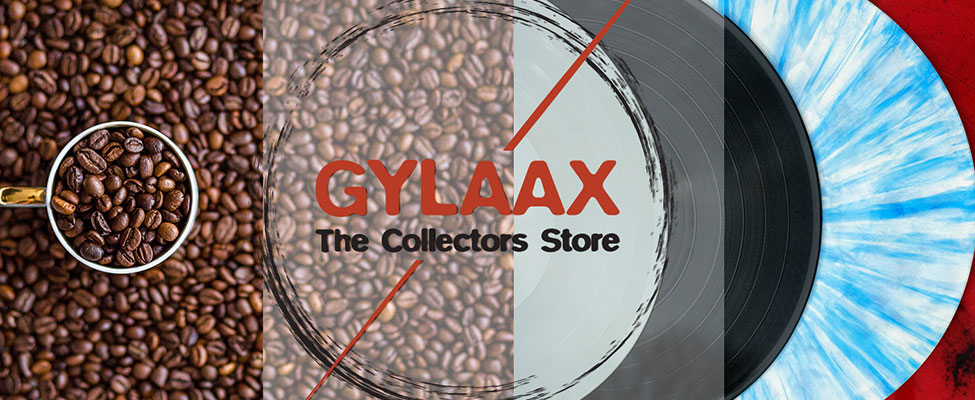Das Filmarchiv Austria ist der Ort, an dem Hedy Lamarr wieder sprechen darf. Ein Nachlass zwischen Glamour, Flucht und kultureller Rückkehr.
Der Nachlass von Hedwig Kiesler/Hedy Lamarr hat endlich eine dauerhafte Heimat gefunden. Es ist eine jener Wendungen, wie sie nur das kulturelle Gedächtnis einer Stadt wie Wien hervorbringen kann: Lange Zeit zwischen luxuriösen Immobilienplänen, Museumsambitionen und juristischen Hängepartien zerrieben, kehrt der Nachlass vom Hollywoodstar und Erfinderin dorthin zurück, wo er hingehört – in eine öffentliche, kulturelle Institution. Kein Glamour, kein Kommerz, sondern Gedächtnis als Schlusspunkt einer langen, fast filmischen Odyssee, die 2021 mit dem aufrichtigen Bemühen des Jüdischen Museum Wien begann, deren Finanzierung jedoch scheiterte. René Benkos Signa Holding wollte es daraufhin zum Markenkern eines neuen Luxuskaufhauses Lamarr machen, als Dekoration mit Bildern, Kleidungsstücken und ihrer Signatur, das Glamour und Kommerz verschmelzen sollte. Es kam alles anders und die Objekte drohten erneut in private Hände zu zersplittern – bis das Filmarchiv Austria eingriff und die Sammlung übernahm. Damit gewann weder ein Museum, noch ein Konzern, sondern eine Gedächtnisinstitution.
Rückblende: Wien, 1937
Hedwig Eva Maria Kiesler war 23 Jahre alt, als sie die Stadt verließ, die ihre Schönheit in fünf Filmen bewunderte und sie zugleich kontrollierte. 1933 hatte sie in Gustav Machatýs Film "Ekstase" die Leinwandrevolution gewagt: nackt, selbstbestimmt, lustvoll. Eine junge Frau, die ihren Körper nicht dem männlichen Blick überließ, sondern ihn selbstbewusst in Szene setzte – ein Skandal und eine Befreiung zugleich. Kieslers Gesicht, makellos symmetrisch, ihre Bewegungen, kontrolliert und doch leicht – sie wurde zur Projektionsfläche für das, was weibliche Selbstinszenierung sein konnte. "Ekstase" war mehr als ein Film: Es war ein kulturgeschichtlicher Moment, der eine neue Form weiblichen Selbstwertgefühls einleitete, lange bevor dieser Begriff zum Schlagwort wurde. 1937 floh sie über Paris nach London und schließlich in die USA. Es war eine Flucht vor dem Ehemann, der ihre Karriere kontrollieren und ihren Körper besitzen wollte, sowie vor der politischen Enge des autoritären Österreich und nicht zuletzt vor dem wachsenden Einfluss des NS-Regimes. "Die schönste Frau der Welt", wie Max Reinhardt sie in Berlin der Presse vorstellte, musste nun zur schönsten Frau Hollywoods werden.
Filmstar und Erfinderin
Als Hedy Lamarr wurde sie zur Ikone einer Ära. Zwischen 1938 und 1958 trat sie in insgesamt 25 Filmen wie "Algiers", "Samson and Delilah", "Ziegfeld Girl", "A Lady without Passport" auf, sei es als exotische Schönheit, Femme fatale, göttliche Erscheinung oder aber auch als eine Shoah-Überlebende, deren tätowierte Nummer am Arm wie zufällig zu sehen ist. Die mediale Präsenz der "most beautiful woman in the world", wie sie die Filmstudios in Hollywood nannten, überschattete oft die andere Hedy Lamarr, die um die Gestaltung moderner Frauenrollen rang. Hinter dieser Fassade verbarg sich außerdem ein scharfer Verstand. Im Zweiten Weltkrieg entwickelte Hedy Lamarr gemeinsam mit dem Komponisten George Antheil das Frequenzsprungverfahren, eine Technik, die später Grundlage für WLAN und Bluetooth werden sollte. Nach dem Krieg hätte man erwarten können, dass Österreich Hedy Lamarr einlädt, dass sie wieder zurückkommt. Doch der Anruf blieb aus und Lamarr blieb in den USA – verehrt und vergessen zugleich. In Österreich wurde sie Jahrzehnte lang bestenfalls als frivole Filmdiva erinnert, kaum als technische Pionierin oder Exilantin. Erst spät, als ihr Lebenswerk in den USA und in Fachkreisen Anerkennung fand, begann auch Wien, sich zu erinnern. 25 Jahre nach ihrem Tod kehrt Hedy Lamarr nicht physisch, aber materiell zurück. Teile der aus über 800 Objekten bestehenden Sammlung wie Kleider, Fotos, Wissenschaftliche Unterlagen und Patente, Korrespondenzen, audiovisuelle Materialien und Digitale Assets sollen ab 2026 im Metro Kinokulturhaus gezeigt werden. Es kann Wissenschaft, Publikum und Erinnerung zusammenbringen. Damit wird aus einem schwebenden Erbe ein kulturell verankertes Projekt. Dennoch bleibt die Herausforderung wie man einen Nachlass transformiert, der zwischen Privatem und Öffentlichkeit, zwischen Kommerz und Kultur zerrieben wurde, in etwas, das sowohl ästhetisch als auch historisch Bestand hat, denn die Geschichte dieses Nachlasses erzählt nicht nur von einer Frau, sondern auch von der wechselhaften Beziehung einer Stadt zu ihrem eigenen Gedächtnis. //
Text: Manfred Horak
Abbildung: Filmarchiv Austria
Gefällt Ihnen der Artikel? Jeder Beitrag zählt!
paypal.me/gylaax
Kulturwoche.at ist ein unabhängiges Online-Magazin, das ohne Förderung von Bund/Stadt/Land bzw. Großsponsoring auskommt.